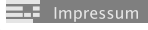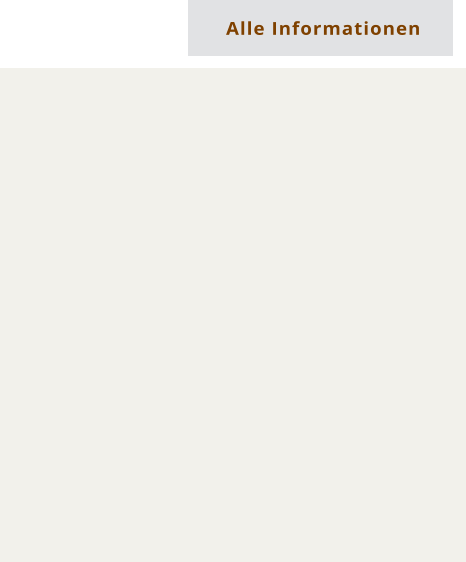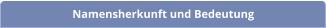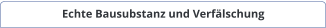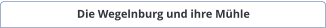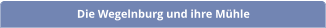Auch die Wegelnburg veranschaulicht nachdrücklich die Irrwege der
Burgenforschung.
Erstmals 1247 mit einem, zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbenen
Burkhard) von Wegelnburg nachweisbar, der zahlreiche Reichslehen
besessen hatte und der Reichsministerialität angehört haben könnte,
sind lange Zeit weder Zeitpunkt der Eroberung noch der Hintergrund in
den Zusammenhang eingeordnet und erkannt worden. Das ist umso
erstaunlicher, als die relevante Schriftquelle -die wenige Jahre nach der
Belagerung abgefassten, bis 1288/97 reichenden „Annalen des
Straßburgers Ellenhard“ - bereits seit
1861 als maßgebliche Edition vorliegt. Nach Ellenhard wurde die
Wegelnburg „am
Donnerstag vor St. Jakob", also am 23. Juli 1282, von den Straßburger
Bürgern und vom Herren von Ochsenstein, dem Vogt des Elsass,
belagert. Dass mit Otto von Ochsenstein — gemeint ist Otto IV. aus der
elsässischen Familie von Ochsenstein— der Landvogt im Elsass
teilnahm, deklariert den Vorgang eindeutig als Landfriedensaktion und
sorgt für einen weiteren passenden Anhaltspunkt hinsichtlich der
Datierung, auch wenn keine weiteren Details bekannt sind.
Ungeachtet dieses eindeutigen und klaren Quellenbefundes wird in fast
allen Studien bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Jahr 1272 genannt,
was nicht nur wegen der Verlegung der Belagerung in die Zeit des
Interregnums von fataler Konsequenz ist. Die Ursache für die
entscheidende Fehldatierung liegt darin begründet, dass die Literatur
über die Wegelnburg seit dem 19. Jahrhundert immer wieder auf zwei
spätere Überlieferungen zurückgegriffen
hat, die beide eine jeweils falsche Jahresangabe aufweisen. Dabei fand
weniger die bis 1362 reichende wichtige Chronik Friedrich/Fritsche
Closeners Seite 101 (mit falscher
Jahresangabe) Verwendung, die das Jahr 1292 nennt, sondern zumeist
die noch jüngere, die Ereignisse bis 1400/1415 schildernde Chronik
Jacob Twingers von Königshofen, der 1272 angibt.
Damit lässt sich festhalten, dass die Wegelnburg im Rahmen einer
Landfriedensaktion von einem straßburgischen Aufgebot, unter Führung
des elsässischen Landvogtes Otto IV. von Ochsenstein, am 23. Juli 1282
belagert worden ist. Ob die Burg jedoch „gewunnen und zerbrochen“
wurde, lässt sich nicht belegen. Die Belagerung könnte auch mit der
Übergabe der Burg beendet worden sein.
Aus diesem Hinweis auf eine Belagerung, werden bis heute
Fehlinterpretationen vorgenommen, so die immer wieder auftretenden
Hinweise auf eine Zerstörung der Burg wegen Raumrittertum. Diese
sind ebenso falsch, wie die Behauptung der ehemalige Vogt der
Wegelsburg, Qualbert von Gerolseck, sei ein Raubritter gewesen.
Es müssen dazu, die in diesem Zeitraum aufgetretenen ganzen
Zusammenhänge betrachten werden, insbesondere das Interregnum. Es
zeigt sich dann, dass keineswegs sicher ist, dass die Wegelnburg bei
ihrer Einnahme durch den elsässischen Landvogt Otto von Ochsenstein
zerstört worden ist, bzw. in größerem Umfang Schäden an der Anlage
entstanden sind.
Sicher ist, dass die Belagerung der Burg im Zusammenhang mit der
Revindikationspolitik König Rudolfs von Habsburg stehen muss. Mit
seiner Wahl zum römisch-deutschen König (1273) endete das
Interregnum. Als König versuchte Rudolf die Rückgewinnung
(Revindikation) des fast vollständig verlorengegangenen Reichsgutes.
Je nachdem, welches Ereignis als das Wichtigere angesehen wird, kann
man den Beginn des Interregnums entweder auf den Tag der Absetzung
Kaiser Friedrichs II. durch Papst Innozenz IV. am 17. Juli 1245 oder auf
den Tod des Kaisers am 13. Dezember 1250 legen. Mit seinem Tod
begann eine lange kaiserlose Zeit. Mit dem Untergang der staufischen
Familie Friedrichs II. in Sizilien gab es ab 1256 im deutschen Reich keine
zentrale politische und administrative Gewalt mehr, denn die Fürsten
hatten mit der Wahl eines neuen Königs keine Eile. Die Fürsten konnten
von dieser königslosen Situation nur profitieren, denn nun herrschten
sie völlig eigenständig und ungestört als unabhängige Territorialherren
("domini terrae") über ihre Gebiete; ein König konnte ihnen nur noch als
Quelle neuer Privilegien von Nutzen sein.
Auch wenn das Reich nun keineswegs ein rechtsfreier Raum war, blühte
doch angesichts einer fehlenden zentralen Polizeigewalt Faustrecht und
Raubritterwesen. Bauern und Städte litten unter den egoistischen
Interessen der Territorialherren, welche durch willkürliche Zollschranken
den Handel behinderten und unter den verarmten Adelsschichten, die
zu Raubrittern herabgesunken waren. Hier wurden die Weichen für die
wirtschaftliche Zerstückelung Deutschlands gestellt, denn die ehemals
königlichen Regalien

Rudolf von Habsburg,
Grabplatte um 1285 im Speyerer Dom
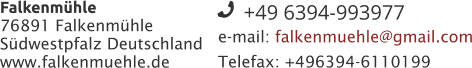

waren zum großen Teil in die Hände der Fürsten
übergegangen und blieben auch da.
Die Königswahl wurde nun zum Geschäft von sieben
"Kurfürsten", deren Mehrheit die Kandidaten für den
Thron durch Bestechung zu gewinnen suchen mussten:
Dazu gehörten
die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier, der Herzog
von Sachsen, der Pfalzgraf vom Rhein, der Markgraf
von Brandenburg und (ab 1289) der König von
Böhmen, welche sich allmählich in dieser festen
Zusammenstellung herauskristallisierten.
Zwei ausländische Kandidaten, die das Königtum als
Sprungbrett zum Kaisertitel
betrachteten, kauften sich in die deutsche Krone ein:
1257 wurde Richard von Cornwall (Bruder König
Heinrichs III. von England) zum König gewählt; er trug
die deutsche Krone bis 1272, wurde aber nur im
Rheinland anerkannt; 1258 wurde Alfons von Kastilien,
ein entfernter Verwandter der Staufer, mit
französischer Unterstützung ebenfalls zum
deutschen König gewählt, setzte jedoch nie einen Fuß
auf deutschen Boden (womit er dann auch nie gekrönt
wurde).
Der mächtigste unter den Reichsfürsten war Ottokar II.
Przemysl, der "goldene König von Böhmen“, der
mütterlicherseits mit den Staufern verwandt war. Trotz
seiner überragenden Stellung unter den Reichsfürsten
hatte er jedoch keine Chance auf die Wahl zum König,
denn diese wollten auf jeden Fall verhindern, dass ein
so mächtiger Herrscher auf den deutschen Thron kam.
Ein vom Papst verlangtes Kollegium wählte 1273 Graf
Rudolf von Habsburg zum König, einen recht
erfolgreichen Territorialherrn aus dem schweizerischen
Aargau, welcher über das südliche Elsass, den Breisgau,
die Nordschweiz und Südschwaben herrschte. Rudolf
gelang
es, gegen das Raubritterwesen durchzugreifen und
stellte somit den Frieden auf den Landstraßen wieder
her und machte sich als nächstes an die
Rückgewinnung der - von diversen Reichsfürsten -
übernommen Königsgüter. 1282 wurde auf dem
Reichstag zu Nürnberg folgendes beschlossen:
Wir, Rudolf, von Gottes Gnaden römischer König, allzeit
Mehrer des Reiches, geben mit dieser Urkunde bekannt
und tun öffentlich kund, dass wir auf unserem feierlichen
Reichstag zu Nürnberg Gericht gehalten haben und dass
alle unsere Fürsten und unsere anderen
Getreuen, die anwesend waren, dem vor uns gefundenen
Spruch Beifall und Zustimmung gespendet haben, dass
nämlich alle Schenkungen aus Sachen oder Gütern des
Reiches von dem erhabenen einstigen König Richard oder
seinen Vorgängern im römischen Reiche seit dem
Absetzungsdekret gegen Kaiser Friedrich II., ob nun
Urkunden vorliegen oder ob es auf andere Weise
geschehen ist, ungültig sein sollen, falls es nicht mit
Zustimmung des größten Teiles der Fürsten, die zu des
Wahl des römischen Königs stimmberechtigt sind,
geschehen
ist.
Zu
Urkunde
dessen
haben
wir
das
vorliegende
Schreiben
ausfertigen
und
mit
dem
Siegel
unserer
Majestät
bekräftigen
lassen.
Gegeben
in
Nürnberg
am
9.
August
im
Jahre
des
Herra
1281,
im
achten
Jahre
unseres
Königtums.
So wurde wohl auf Veranlassung König Rudolfs von
Habsburg, die Wegelnburg von Truppen der Stadt
Straßburg und des elsässischen Landvogtes Otto von
Ochsenstein belagert und in
den Besitz des Reichs zurückgeführt. Dass die
Rückführung bereits in der zweiten Jahreshälfte 1282
stattgefunden hat, unterstreicht die damalige
Bedeutung der Reichsburg Wegelnburg. Den Vorwurf
des Raubrittertums könnte auch nur ein Vorwand für
die
Einnahme der Burg gewesen sein, denn 1282 mussten
die unweit der Wegelnburg ansässigen Herren von
Fleckenstein die benachbarte Burg Löwenstein, im Jahr
darauf die Guttenburg, an den König abtreten (RI
Rudolf 1737, S. 381 u. Nr. 1786, S. 184.).
Fundorte
Alexander Thon „Belagerung und Untergang pfälzisch-elsässischer Burgen im Mittelalter“ Einnahme der Wegelnburg 1282.
Vgl. Alois Gerlich, Studien zur Landfriedenspolitik König Rudolfs von Habsburg (Institut f. Gesch. Landeskunde a. d. Univ. Mainz, Jahresgabe 1963 = Jahresbericht
1962),
Mainz 1963; von Graevenitz 2003 (wie Anm. 10).
Vgl. zu den Herren von Fleckenstein die grundlegende Studie von Peter Müller, Die Herren von Fleckenstein im späten Mittelalter.
Landeskunde 34). Stuttgart 1990, sowie zur Burg zuletzt ders. und Jean-Michel Rudrauf, Fleckenstein.
In: Pfälzisches Burgenlexikon 2 (2002), S. 86-100, sowie Thomas Biller mit Beitr. von Bernhard Metz, Rene Kill und Charles Schlosser.
Burg Fleckenstein (Burgen, Schlösser u. Wehrbauten in Mitteleuropa 11). Regensburg 2003 [ohne Angabe des vorherigen Aufsatzes]. Erwähnt wird in den bis 1277
reichenden Basler Annalen nur die Belagerung eines Herren von Fleckenstein, jedoch nicht die Örtlichkeit;
Annales Basilenses, hrsg. von Philipp Jaffe. In: MGH SS 17. Hannover 1861, S. 193-202, ad annum 1276, S. 199: Rex obsedit dominum de Fleckenstein pro eo quod
ceperat episcopum Spirensem pro pecunia, quam pro adiutorio promiserat. Dominus de Fleckenstein se et sua in regis tradidit potestatem.
Zur Geschichte der Wegelnburg immer noch nicht ersetzt, wenn auch vielfach überholt: Lehmann 1857-66 (wie Anm. 25), Bd. 1, 1857, S.
Zu den baulichen Resten vgl. noch immer grundlegend: Die Kunstdenkmäler der Stadt und des Landkreises Pirmasens (Die Kunstdenkmäler v. Rheinland-Pfalz, Bd.
2), bearb. von Anton Eckardt und Hans E. Kubach. München 1957, S. 436-444 (geschichtlicher Teil unbrauchbar). Eine kurze Zusammenfassung mit neuen
Erkenntnissen bietet ... wie eine gebannte, unnahbare Zauberburg". Burgen in der Südpfalz, hrsg. von Alexander Thon mit Beitr. von Peter Pohlit und Hans Reither.
2., verb. Aufl. Regensburg 2005, S. 158-161.
Fürstlich Leiningensches Archiv Amorbach, Urk. sub dato (= RI 5, Nr. 4520, S. 823, u. RI 5/4, S. 277 zu 4520; Aussteller: Kg. Konrad IV.):... quondam B. de
Woeglenberc ... Esslingen 9. März 1247.
Ellenhardi Argentininsis annales, hrsg. von Philipp Jaffe. In: MGH SS 17. Hannover 1861, S. 101-104, ad annum 1282, S. 103: Anno Domini 1282. feria 5. ante Iacobi
Wegelenburg castrum expugnatum est a eivibus Argentinensibus et domino de Ohsenstein, ad¬vocato Alsatie.
Zu den Herren von Ochsenstein vgl. die grundlegende Zusammenfassung von Bernhard Metz, Sires d'Ochsenstein. In: Nouveau dictionnaire de biographie
Alsacienne 28 (1996), S. 2889-2893.
Otto IV. wurde erst 1280 von König Rudolf von Habsburg, seinem Onkel, zum Landvogt im Elsass und im Breisgau ernannt, weshalb allein schon das Datum 1272
für die Belagerung der Wegelnburg ausscheidet; MGH Const. 3, Nr. 264, S. 257 f. (= Die Regesten des Kaiserreichs unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-
1313: [Rudolf von Habsburg] [Regesta Imperii, 6/1], nach d. Neubearb. u. d. Nachlasse Johann Friedrich Böhmer's neu hrsg. u. erg. von Oswald Redlich. Innsbruck
1898, Nr. 1236, S. 306), Wien 17. Dezember 1280.
So in der jüngeren Literatur bei Wolfgang Schultz, Die Wegelnburg. Aus der Geschichte der Reichsfeste und des Amtes. Nothweiler 1984, S. 16 (vielfache,
insbesondere terminologische Unsicherheiten — gibt nach Königshofen 1272 als Datum der Belagerung an), und offensichtlich danach Jürgen Keddigkeit, Die
Burgengruppe Wegelnburg. In: Der torn soll frey stehn. Burgen im Landkreis Pirmasens, hrsg. von Rolf Übel, Landau 1994, S. 93-99 (nicht nur hinsichtlich des
Erstbeleges fehlerhaft — nennt ebd., S. 93, zwar 1282 als Jahr der Belagerung, zitiert jedoch als Beleg ebenfalls „Jacob von Königshoven" mit dem dortigen Zitat zu
1272!). Besonders ärgerlich nimmt sich die komplett unbrauchbare Beschreibung im leider weit verbreiteten Verzeichnis der staatlichen Burgen von Rheinland-
Pfalz aus: Magnus Backes, Staatliche Burgen, Schlösser und Altertümer in Rheinland-Pfalz (Edition Burgen, Schlösser, Altertümer Rheinland-Pfalz, Führungsheft 7).
Regensburg 2003, S. 194, wo selbst die veraltete Literatur des 19. Jahrhunderts unrichtig wiedergegeben wird. Neben dem Datum 1272 beeindruckt besonders,
dass die angeblich „von den Hohenstaufen (sie!) im 12./13. Jahrhundert" errichtete Wegelnburg „an der französisch¬elsässischen Grenze" liegt (ebd.).
Closener, Chronik, S. 101: Do man zalte 1292 jor, an dem nehesten restage vor saut Jocobes dag in der erne, do wart die burg Wegelnburg gewunnen von den
burgern zu Strosburg und von deme von Ohsenstein lantvoget in Elsaße.
Von Königshofen, Chronik, S. 795: Do men zalte 1272 jor, do wart Wegelnburg gewunnen und zerbrochen von den Burgern von Strosburg und von dem von
Ohssenstein lantvougte in Elsas. Danach die Angaben bei Bernhart Hertzog, Chronicon Alsatiae. Edelsasser Chronick und außfürliche Beschreibung des untern
Elsasses am Rheinstrom, 10 Bücher. Straßburg 1592, B. 3, S. 58: „Anno 1272 wurde Wegelburg durch die von Straßburg /und den von Ochsenstein Landvogt im
Elsaß / gewunnen vnd zerbrochen.
Hinweis:
Veröffentlichungen oder Auszüge sind unter der Voraussetzung der Quellenangabe gestattet:
Form der Quellenangabe, Druckwerke/PDF usw.:
Name des Autors: Peter Müller-Helbling
Titel des Werks: Die Wegelnburg

Die erste Zerstörung der Burg 1272 oder 1282
Auch die Wegelnburg veranschaulicht nachdrücklich
die Irrwege der Burgenforschung.
Erstmals 1247 mit einem, zu diesem Zeitpunkt
bereits verstorbenen Burkhard) von Wegelnburg
nachweisbar, der zahlreiche Reichslehen besessen
hatte und der Reichsministerialität angehört haben
könnte, sind lange Zeit weder Zeitpunkt der
Eroberung noch der Hintergrund in den
Zusammenhang eingeordnet und erkannt worden.
Das ist umso erstaunlicher, als die relevante
Schriftquelle -die wenige Jahre nach der Belagerung
abgefassten, bis 1288/97 reichenden „Annalen des
Straßburgers Ellenhard“ - bereits seit
1861 als maßgebliche Edition vorliegt. Nach
Ellenhard wurde die Wegelnburg „am
Donnerstag vor St. Jakob", also am 23. Juli 1282, von
den Straßburger Bürgern und vom Herren von
Ochsenstein, dem Vogt des Elsass, belagert. Dass mit
Otto von Ochsenstein — gemeint ist Otto IV. aus der
elsässischen Familie von Ochsenstein— der
Landvogt im Elsass teilnahm, deklariert den Vorgang
eindeutig als Landfriedensaktion und sorgt für einen
weiteren passenden Anhaltspunkt hinsichtlich der
Datierung, auch wenn keine weiteren Details
bekannt sind.
Ungeachtet dieses eindeutigen und klaren Quellen-
befundes wird in fast allen Studien bis zum
gegenwärtigen Zeitpunkt das Jahr 1272 genannt, was
nicht nur wegen der Verlegung der Belagerung in die
Zeit des Interregnums von fataler Konsequenz ist.
Die Ursache für die entscheidende Fehldatierung
liegt darin begründet, dass die Literatur über die
Wegelnburg seit dem 19. Jahrhundert immer wieder
auf zwei spätere Überlieferungen zurückgegriffen
hat, die beide eine jeweils falsche Jahresangabe
aufweisen. Dabei fand weniger die bis 1362
reichende wichtige Chronik Friedrich/Fritsche
Closeners Seite 101 (mit falscher Jahresangabe)
Verwendung, die das Jahr 1292 nennt, sondern
zumeist die noch jüngere, die Ereignisse bis
1400/1415 schildernde Chronik Jacob Twingers von
Königshofen, der 1272 angibt.
Damit lässt sich festhalten, dass die Wegelnburg im
Rahmen einer Landfriedensaktion von einem
straßburgischen Aufgebot, unter Führung des
elsässischen Landvogtes Otto IV. von Ochsenstein,
am 23. Juli 1282 belagert worden ist. Ob die Burg
jedoch „gewunnen und zerbrochen“ wurde, lässt
sich nicht belegen. Die Belagerung könnte auch mit
der Übergabe der Burg beendet worden sein.
Aus diesem Hinweis auf eine Belagerung, werden bis
heute Fehlinterpretationen vorgenommen, so die
immer wieder auftretenden Hinweise auf eine
Zerstörung der Burg wegen Raumrittertum. Diese
sind ebenso falsch, wie die Behauptung der
ehemalige Vogt der Wegelsburg, Qualbert von
Gerolseck, sei ein Raubritter gewesen.
Es müssen dazu, die in diesem Zeitraum
aufgetretenen ganzen Zusammenhänge betrachten
werden, insbesondere das Interregnum. Es zeigt sich
dann, dass keineswegs sicher ist, dass die
Wegelnburg bei ihrer Einnahme durch den
elsässischen Landvogt Otto von Ochsenstein zerstört
worden ist, bzw. in größerem Umfang Schäden an
der Anlage entstanden sind.
Sicher ist, dass die Belagerung der Burg im
Zusammenhang mit der Revindikationspolitik König
Rudolfs von Habsburg stehen muss. Mit seiner Wahl
zum römisch-deutschen König (1273) endete das
Interregnum. Als König versuchte Rudolf die
Rückgewinnung (Revindikation) des fast vollständig
verlorengegangenen Reichsgutes.
Je nachdem, welches Ereignis als das Wichtigere
angesehen wird, kann man den Beginn des
Interregnums entweder auf den Tag der Absetzung
Kaiser Friedrichs II. durch Papst Innozenz IV. am 17.
Juli 1245 oder auf den Tod des Kaisers am 13.
Dezember 1250 legen. Mit seinem Tod begann eine
lange kaiserlose Zeit. Mit dem Untergang der
staufischen Familie Friedrichs II. in Sizilien gab es ab
1256 im deutschen Reich keine zentrale politische
und administrative Gewalt mehr, denn die Fürsten
hatten mit der Wahl eines neuen Königs keine Eile.
Die Fürsten konnten von dieser königslosen
Situation nur profitieren, denn nun herrschten sie
völlig eigenständig und ungestört als unabhängige
Territorialherren ("domini terrae") über ihre Gebiete;
ein König konnte ihnen nur noch als Quelle neuer
Privilegien von Nutzen sein.
Auch wenn das Reich nun keineswegs ein
rechtsfreier Raum war, blühte doch angesichts einer
fehlenden zentralen Polizeigewalt Faustrecht und
Raubritterwesen. Bauern und Städte litten unter den
egoistischen Interessen der Territorialherren, welche
durch willkürliche Zollschranken den Handel
behinderten und unter den verarmten
Adelsschichten, die zu Raubrittern herabgesunken
waren. Hier wurden die Weichen für die
wirtschaftliche Zerstückelung Deutschlands gestellt,
denn die ehemals königlichen Regalien waren zum
großen Teil in die Hände der Fürsten übergegangen
und blieben auch da.
Die Königswahl wurde nun zum Geschäft von sieben
"Kurfürsten", deren Mehrheit die Kandidaten für den
Thron durch Bestechung zu gewinnen suchen
mussten: Dazu gehörten die Erzbischöfe von Köln,
Mainz und Trier, der Herzog von Sachsen, der
Pfalzgraf vom Rhein, der Markgraf von Brandenburg
und (ab 1289) der König von Böhmen, welche sich
allmählich in dieser festen Zusammenstellung
herauskristallisierten.
Zwei ausländische Kandidaten, die das Königtum als
Sprungbrett zum Kaisertitel betrachteten, kauften
sich in die deutsche Krone ein: 1257 wurde Richard
von Cornwall (Bruder König Heinrichs III. von
England) zum König gewählt; er trug die deutsche
Krone bis 1272, wurde aber nur im Rheinland
anerkannt; 1258 wurde Alfons von Kastilien, ein
entfernter Verwandter der Staufer, mit französischer
Unterstützung ebenfalls zum deutschen König
gewählt, setzte jedoch nie einen Fuß auf deutschen
Boden (womit er dann auch nie gekrönt wurde).
Der mächtigste unter den Reichsfürsten war Ottokar
II. Przemysl, der "goldene König von Böhmen“, der
mütterlicherseits mit den Staufern verwandt war.
Trotz seiner überragenden Stellung unter den
Reichsfürsten hatte er jedoch keine Chance auf die
Wahl zum König, denn diese wollten auf jeden Fall
verhindern, dass ein so mächtiger Herrscher auf den
deutschen Thron kam.
Ein vom Papst verlangtes Kollegium wählte 1273
Graf Rudolf von Habsburg zum König, einen recht
erfolgreichen Territorialherrn aus dem
schweizerischen Aargau, welcher über das südliche
Elsass, den Breisgau, die Nordschweiz und
Südschwaben herrschte. Rudolf gelang es, gegen das
Raubritterwesen durchzugreifen und stellte somit
den Frieden auf den Landstraßen wieder her und
machte sich als nächstes an die Rückgewinnung der -
von diversen Reichsfürsten - übernommen
Königsgüter. 1282 wurde auf dem Reichstag zu
Nürnberg folgendes beschlossen:
Wir, Rudolf, von Gottes Gnaden römischer König, allzeit
Mehrer des Reiches, geben mit dieser Urkunde bekannt
und tun öffentlich kund, dass wir auf unserem
feierlichen Reichstag zu Nürnberg Gericht gehalten
haben und dass alle unsere Fürsten und unsere
anderen Getreuen, die anwesend waren, dem vor uns
gefundenen Spruch Beifall und Zustimmung gespendet
haben, dass nämlich alle Schenkungen aus Sachen oder
Gütern des Reiches von dem erhabenen einstigen König
Richard oder seinen Vorgängern im römischen Reiche
seit dem Absetzungsdekret gegen Kaiser Friedrich II., ob
nun Urkunden vorliegen oder ob es auf andere Weise
geschehen ist, ungültig sein sollen, falls es nicht mit
Zustimmung des größten Teiles der Fürsten, die zu des
Wahl des römischen Königs stimmberechtigt sind,
geschehen ist. Zu Urkunde dessen haben wir das
vorliegende Schreiben ausfertigen und mit dem Siegel
unserer Majestät bekräftigen lassen. Gegeben in
Nürnberg am 9. August im Jahre des Herra 1281, im
achten Jahre unseres Königtums.
So wurde wohl auf Veranlassung König Rudolfs von
Habsburg, die Wegelnburg von Truppen der Stadt
Straßburg und des elsässischen Landvogtes Otto von
Ochsenstein belagert und in den Besitz des Reichs
zurückgeführt. Dass die Rückführung bereits in der
zweiten Jahreshälfte 1282 stattgefunden hat,
unterstreicht die damalige Bedeutung der
Reichsburg Wegelnburg. Den Vorwurf des Raub-
rittertums könnte auch nur ein Vorwand für die
Einnahme der Burg gewesen sein, denn 1282
mussten die unweit der Wegelnburg ansässigen
Herren von Fleckenstein die benachbarte Burg
Löwenstein, im Jahr darauf die Guttenburg, an den
König abtreten (RI Rudolf 1737, S. 381 u. Nr. 1786, S.
184.).

Rudolf von Habsburg,
Grabplatte um 1285 im Speyerer Dom
Fundorte
Alexander Thon „Belagerung und Untergang pfälzisch-
elsässischer Burgen im Mittelalter“ Einnahme der
Wegelnburg 1282.
Vgl. Alois Gerlich, Studien zur Landfriedenspolitik König
Rudolfs von Habsburg (Institut f. Gesch. Landeskunde a. d.
Univ. Mainz, Jahresgabe 1963 = Jahresbericht 1962),
Mainz 1963; von Graevenitz 2003 (wie Anm. 10).
Vgl. zu den Herren von Fleckenstein die grundlegende Studie
von Peter Müller, Die Herren von Fleckenstein im späten
Mittelalter.
Landeskunde 34). Stuttgart 1990, sowie zur Burg zuletzt
ders. und Jean-Michel Rudrauf, Fleckenstein.
In: Pfälzisches Burgenlexikon 2 (2002), S. 86-100, sowie
Thomas Biller mit Beitr. von Bernhard Metz, Rene Kill und
Charles Schlosser.
Burg Fleckenstein (Burgen, Schlösser u. Wehrbauten in
Mitteleuropa 11). Regensburg 2003 [ohne Angabe des
vorherigen Aufsatzes]. Erwähnt wird in den bis 1277
reichenden Basler Annalen nur die Belagerung eines Herren
von Fleckenstein, jedoch nicht die Örtlichkeit;
Annales Basilenses, hrsg. von Philipp Jaffe. In: MGH SS 17.
Hannover 1861, S. 193-202, ad annum 1276, S. 199: Rex
obsedit dominum de Fleckenstein pro eo quod ceperat
episcopum Spirensem pro pecunia, quam pro adiutorio
promiserat. Dominus de Fleckenstein se et sua in regis
tradidit potestatem.
Zur Geschichte der Wegelnburg immer noch nicht ersetzt,
wenn auch vielfach überholt: Lehmann 1857-66 (wie Anm.
25), Bd. 1, 1857, S.
Zu den baulichen Resten vgl. noch immer grundlegend: Die
Kunstdenkmäler der Stadt und des Landkreises Pirmasens
(Die Kunstdenkmäler v. Rheinland-Pfalz, Bd. 2), bearb. von
Anton Eckardt und Hans E. Kubach. München 1957, S. 436-
444 (geschichtlicher Teil unbrauchbar). Eine kurze
Zusammenfassung mit neuen Erkenntnissen bietet ... wie
eine gebannte, unnahbare Zauberburg". Burgen in der
Südpfalz, hrsg. von Alexander Thon mit Beitr. von Peter
Pohlit und Hans Reither. 2., verb. Aufl. Regensburg 2005, S.
158-161.
Fürstlich Leiningensches Archiv Amorbach, Urk. sub dato (=
RI 5, Nr. 4520, S. 823, u. RI 5/4, S. 277 zu 4520; Aussteller:
Kg. Konrad IV.):... quondam B. de Woeglenberc ... Esslingen
9. März 1247.
Ellenhardi Argentininsis annales, hrsg. von Philipp Jaffe. In:
MGH SS 17. Hannover 1861, S. 101-104, ad annum 1282, S.
103: Anno Domini 1282. feria 5. ante Iacobi Wegelenburg
castrum expugnatum est a eivibus Argentinensibus et
domino de Ohsenstein, ad¬vocato Alsatie.
Zu den Herren von Ochsenstein vgl. die grundlegende
Zusammenfassung von Bernhard Metz, Sires d'Ochsenstein.
In: Nouveau dictionnaire de biographie Alsacienne 28
(1996), S. 2889-2893.
Otto IV. wurde erst 1280 von König Rudolf von Habsburg,
seinem Onkel, zum Landvogt im Elsass und im Breisgau
ernannt, weshalb allein schon das Datum 1272 für die
Belagerung der Wegelnburg ausscheidet; MGH Const. 3, Nr.
264, S. 257 f. (= Die Regesten des Kaiserreichs unter Rudolf,
Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313: [Rudolf von
Habsburg] [Regesta Imperii, 6/1], nach d. Neubearb. u. d.
Nachlasse Johann Friedrich Böhmer's neu hrsg. u. erg. von
Oswald Redlich. Innsbruck 1898, Nr. 1236, S. 306), Wien 17.
Dezember 1280.
So in der jüngeren Literatur bei Wolfgang Schultz, Die
Wegelnburg. Aus der Geschichte der Reichsfeste und des
Amtes. Nothweiler 1984, S. 16 (vielfache, insbesondere
terminologische Unsicherheiten — gibt nach Königshofen
1272 als Datum der Belagerung an), und offensichtlich
danach Jürgen Keddigkeit, Die Burgengruppe Wegelnburg.
In: Der torn soll frey stehn. Burgen im Landkreis Pirmasens,
hrsg. von Rolf Übel, Landau 1994, S. 93-99 (nicht nur
hinsichtlich des Erstbeleges fehlerhaft — nennt ebd., S. 93,
zwar 1282 als Jahr der Belagerung, zitiert jedoch als Beleg
ebenfalls „Jacob von Königshoven" mit dem dortigen Zitat zu
1272!). Besonders ärgerlich nimmt sich die komplett
unbrauchbare Beschreibung im leider weit verbreiteten
Verzeichnis der staatlichen Burgen von Rheinland-Pfalz aus:
Magnus Backes, Staatliche Burgen, Schlösser und Altertümer
in Rheinland-Pfalz (Edition Burgen, Schlösser, Altertümer
Rheinland-Pfalz, Führungsheft 7). Regensburg 2003, S. 194,
wo selbst die veraltete Literatur des 19. Jahrhunderts
unrichtig wiedergegeben wird. Neben dem Datum 1272
beeindruckt besonders, dass die angeblich „von den
Hohenstaufen (sie!) im 12./13. Jahrhundert" errichtete
Wegelnburg „an der französisch¬elsässischen Grenze" liegt
(ebd.).
Closener, Chronik, S. 101: Do man zalte 1292 jor, an dem
nehesten restage vor saut Jocobes dag in der erne, do wart
die burg Wegelnburg gewunnen von den burgern zu
Strosburg und von deme von Ohsenstein lantvoget in Elsaße.
Von Königshofen, Chronik, S. 795: Do men zalte 1272 jor, do
wart Wegelnburg gewunnen und zerbrochen von den
Burgern von Strosburg und von dem von Ohssenstein
lantvougte in Elsas. Danach die Angaben bei Bernhart
Hertzog, Chronicon Alsatiae. Edelsasser Chronick und
außfürliche Beschreibung des untern Elsasses am
Rheinstrom, 10 Bücher. Straßburg 1592, B. 3, S. 58: „Anno
1272 wurde Wegelburg durch die von Straßburg /und den
von Ochsenstein Landvogt im Elsaß / gewunnen vnd
zerbrochen.
Hinweis:
Veröffentlichungen oder Auszüge sind unter der
Voraussetzung der Quellenangabe gerne gestattet:
Form der Quellenangabe, Druckwerke/PDF usw.:
Name des Autors: Peter Müller-Helbling
Titel des Werks: Die Wegelnburg
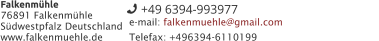
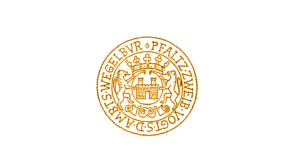
„ Die erste Zerstörung der Burg
1272 oder 1282“
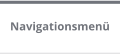

- Vorwort
- Lage Klima Zugang
- Burg Rekonstruktionen
- Die erste Zerstörung der Burg
- Namensherkunft
- Friedrich II. der Erbauer der Burg
- Eine der größte Burganlagen der Pfalz
- Wasserversorgung, Brunnen, Zisternen
- Die Toilettenanlage der Burg
- Die Burg mit verfälschter Bausubstanz
- Baubeschreibung untere Burg
- Die Wegelnburg und ihre Mühle
- Die endgültige Zerstörung
- Ein Wort des Verfassers
- Impressum
- Baubeschreibung mittlere Burg
- Baubeschreibung obere Burg
- Friedrich II.